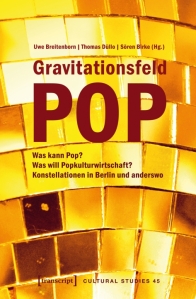„Betrug“ und „Skandal“, so hallt es am 1. Konferenztag der Berlin Music Week (BMW) durch den Postbahnhof. Dieter Meier (Yello) sitzt auf dem Eröffnungspodium der WORD! -Konferenz und macht erst mal alle Anwesenden richtig wach. Streaming, der neuer Streif am Horizont des sich jahrelang immer mehr verdüsternden Musikindustriehimmels? Sind Musikstreamingportale wie Spotify eine neue Möglichkeit für Künstler_innen endlich wieder Geld mit ihrer Musik zu verdienen? Nicht für Dieter Meier. Denn auch mit Streamingzahlen im Millionenbereich wird man bei Spotify mit so wenig Geld abgespeist, dass „es kaum reicht die Wasserrechnung zu zahlen“, so Meier. Die Intransparenz, was Zahlen, Abrechnungsmodi und faire prozentuale Beteiligung der Musiker_innen angeht, prangert er dabei weniger in Bezug auf seine Person an, schließlich habe er das Glück gehabt mit Yello mehrere Millionen (physische) Tonträger verkauft zu haben, sondern vor allem stellvertretend für junge Künstler_innen, die in der „Ära nach der CD“ auf neue Absatzmöglichkeiten angewiesen sind.
Da sind wir dann schon mitten im Themenschwerpunkt der fünften BMW angekommen: Digitalisierung und Streaming. Ein wenig abseits finden sich aber interessante Nischen, die pop- und jugendkulturelle Entwicklungen in den Fokus nehmen. Da gibt es dann Fragen zur Indie- Ästhetik heute, ein bisschen Popfeminismus- und Diversitydiskurs und als Glasur noch Bestandsaufnahmen zu DIY-Strukturen im urbanen Raum und politischen Haltungsfragen im Pop obendrauf.
Von DIY zu DIT
Wie in DIY-Strukturen professionell arbeiten? Dieser Frage stellen sich verschiedene Akteur_innen, die seit vielen Jahren in der Berliner und Hamburger Club- und Labelandschaft (u.a. Schokoladen, about blank, Audiolith) als DIY-Booker_innen, Veranstalter_innen und Labelbetreiber_innen aktiv sind. Zugegeben, ein etwas widersprüchliches Unterfangen bei DIY überhaupt in Chiffren von Professionalität zu denken. Der Ausgangsfrage wird im Gespräch dann auch nur wenig Raum gegeben. Es geht vielmehr um Aspekte wie Authentizität, den Kollektivgedanken, Fairness im Umgang mit Bands, Spaß bei der Sache und natürlich um die Liebe zur Musik an sich. Hauptsache keinen Job machen, den man hasst und schon gar nicht in Abhängigkeit arbeiten, so das Credo. Da verwundert es dann auch nicht, dass alle in die Empowerment-Hymne einstimmen und „denen da draußen“ als Ratschlag auf den Weg geben, sich und ihre Ideen einfach auszuprobieren. Und das natürlich am besten nicht alleine, sondern in einem Netzwerk ähnlich interessierter Menschen, am besten Freund_innen, um im Sinne einer Bottom-up-Strategie gemeinsam Nischen für selbstverwaltete Freiräume und Veranstaltungen zu besetzen. Denn der Sinn hinter „Do it yourself“ (DIY) soll weniger als ein „Mach alles alleine“, sondern eher als ein gemeinsames Tun, ein „Do it together“ (DIT) verstanden und gelebt werden. Wie leicht es heute noch ist in einem immer stärker spekulationsverseuchten Berlin solche Freiräume zu etablieren und aufrechtzuerhalten, das sollen sich „die da draußen“ dann aber doch lieber selbst beantworten.
Did we make any progress? 20 Jahre nach dem Riot Grrrl Manifest
„Revolution Girl Style Now“. Mehr als 20 Jahre nach der so betitelten Bikini-Kill-Platte und dem Riot Grrrl Manifest, erstaunt mich, dass mir 2014 ein Panel mit diesem Titel ins Auge springt, um auf den zweiten Blick zu fragen, wie es um die Rolle und Sichtbarkeit von Frauen im Musikgeschäft heute bestellt ist.
Sonja Eismann (Missy Magazin) deprimiert dann gleich zu Anfang. Das hat weniger mit ihrer Moderationsleistung zu tun, als vielmehr mit den ernüchternden Zahlen, die sie zum Diskussionseinstieg liefert. Denn auch die Musikindustrie, welch Wunder, ist ein Abziehbild der Gesamtgesellschaft. Auch hier greifen und perpetuieren sich Mechanismen und Strukturen der Ungleichbehandlung von Männern und Frauen. So verdienen Frauen auch in der Musikindustrie deutlich weniger als Männer, findet man in den Führungsetagen der Labels eher selten eine Frau und auch bei der Produktion von Musik überflügeln Männer Frauen um Längen.
Dem Impuls aufzustehen und mich lieber in die Sonne zu setzen, widerstehe ich nur knapp, denn Eismann beteuert „We are not here to complain“. Doch die Frage, ob sich in den vergangenen Jahren eine sichtbare Entwicklung zum Besseren ausmachen lässt, wird wenn nur zaghaft positiv beantwortet. Die Rede ist da von mehr „Awareness“ dem Thema gegenüber (Electric Indigo/ Female Pressure). Es wird also mehr darüber diskutiert, was sich jedoch immer noch viel zu wenig in der Praxis bemerkbar macht. Jetzt bin ich nicht mehr nur deprimiert, sondern fast schon desillusioniert. Doch: ein Lichtblick. So recht weiß zwar keiner warum, aber das Berghain hat im vergangenen Jahr mehr weibliche DJs gebucht als jemals zuvor. Momentaufnahme oder doch ein erstes Aufbrechen verkrusteter Entscheidungsstrukturen im Zuge der Female Pressure Studie 2013?
Aber eine wirkliche Revolution à la Girl Style muss doch anders aussehen? Mehr Empowerment. Natürlich! Etablierte Musikerinnen sollen ihre Vorbild- und Mentoringfunktion für Nachwuchskünstlerinnen stärker wahrnehmen. Absolut! Bei Quotenregelungen und speziellen Musikawards für Künstlerinnen gehen die Meinungen dann doch stärker auseinander. Vor allem in Bezug auf die Wirkung und Symbolkraft dieser Instrumente, die in der öffentlichen Wahrnehmung auch mal nach hinten losgehen kann und Geschlecht eher als unterscheidendes Merkmal manifestiert, als diese Kategorie obsolet zu machen. Das zeigt nicht zuletzt die jahrelang geführte Debatte über die Einführungen von Frauenquoten in anderen gesellschaftlichen Teilsystemen.
Am Ende bleibt: Alles keine schlechten Ideen, aber irgendwie schon tausendmal gehört. Wirklich revolutionäre Lösungsansätze sucht man vergebens. Ich muss an eine Textzeile aus dem Song „Rebel Girl“ (Bikini Kill) denken: „When she talks, I hear the revolution“ singt Kathleen Hanna. So ein Rebel Girl hätte diesem Panel sicher auch ganz gut getan.
Die neue Indieästehtik ist Hi-Tech
Adam Harper reißt mich dann mit seinen Vortrag „Indie goes Hi-Tech“ aus meiner 90er-Jahre-Nostalgie. Obwohl er mit einer Szene aus Portlandia, einer amerikanischen Comedyserie mit Fred Armisen (Saturday Night Live) und Carrie Brownstein (Sleater Kinney, Wild Flag) beginnt. „We put a bird on it“ heißt es da und „The Dream of the 90s is alive in Portland“. Doch wer sich jetzt in sicheren Gefilden wähnt, was Stile, Referenzen und Codes der heutigen Indie-Kultur angeht, den duscht Harper schon gleich im nächsten Augenblick wieder kalt ab. Seiner Meinung nach gehört die in Portlandia zelebrierte Indie-Ästhetik schon längst der Vergangenheit an und ist nur noch was für Nostalgiker_innen, die in den 80ern groß geworden sind. Autsch, getroffen.
Das naiv verspielte, oftmals charmant rohe und selbstgemachte ist vielmehr einer unterkühlten, dekadent anmutenden, modernen Bildsprache in Videos, Plattencovern und Visuals gewichen. Vor allem in der elektronischen Musik verweben sich minimalistische Musikstile mit reduzierten, futuristischen Bildwelten und Motiven. Spannende Vertreter_innen dieser neuen pasticheartigen Indieästhetik sind neben James Ferraro vor allem auch viele Künstlerinnen, wie Fatima al Quadiri, FKA Twigs, Laurel Halo und auch queere Acts wie Le1f und Mykki Blanco. Die neuen Musikgenres heißen Vaporwave oder Cuteness und sind in ihrer Ästhetik auch stark vom Manga-Stil beeinflusst, oft gefährlich nah an klischeehaften Darstellungen, die in Exotismus abzugleiten drohen. Das findet man sicher nicht mehr auf den Parties im Jugendzentrum um die Ecke. Also alle Nostalgie über Board. Jugendliche und Künstler_innen entwerfen ihre Idee von Indie-Ästhetik neu, und diese wird, wie so vieles, von den Möglichkeiten digitaler Technik bestimmt.
We are the Teenagers
Um Jugendliche und technischen Fortschritt geht es auch bei dem „When Teenage Music Fans are your Audience“-Panel. Genauer gesagt, um deren Hörgewohnheiten und Musikkonsumverhalten. In der vorgestellten Studie zeigt sich, dass mittlerweile 90% der Jugendlichen ein Smartphone besitzen und dieses zum Musik hören nutzen. Das tun sie hauptsächlich über Youtube und noch recht verhalten über Spotify (20%). Und nur noch knapp 14% besitzen überhaupt ein Gerät mit dem man CDs abspielen kann.
Wie Jugendliche Musik hören und konsumieren hat sich im Vergleich zu den Vorgängergenerationen somit gravierend verändert. Physische Tonträger (Kassetten, Vinylplatten und CDs) spielen bei Ihnen kaum eine Rolle. In Zeiten von MP3s und der Verbreitung von Musik über das Internet bedeutet das auch, dass ein Großteil der Jugendlichen in ihrer musikalischen Sozialisation nie für das Hören von Musik bezahlt haben und die Frage, die sich daran anschließt und nicht nur die Musikindustrie umtreibt, ist: Warum sollten sie es dann als Erwachsene tun?
Schlechte Haltungsnoten im Pop
Mit schwierigen Fragen startet auch mein letztes Panel „Pop + Politik = Haltung ?“ der BMW. Hat Popmusik heute noch gesellschaftspolitische Relevanz? Was ist Haltung für euch?
Was dann eine gute Stunde lang folgt ist ein diffuses Potpourri aus Gedankenfetzen und Beiträgen, die immer wieder um die sicher nicht einfache Begriffsdefinition Haltung kreisen. Sookee, Rapperin aus Berlin, nähert sich dem Begriff Haltung mit der Unterscheidung zwischen Dogmen („anstrengend“) und Prinzipien („wichtig“). Stoppok, deutscher Rockmusiker, findet, dass heutzutage „eh alle eine Meise haben, die noch Plattenverträge bei Majorlabels unterschreiben“ und Labelbetreiber Gregor (Sounds of Subterannia) übernimmt in der Runde die Rolle des Kulturpessimisten, der in die „früher war alles besser“-Attitüde verfällt und fragt, wo sich heute noch Bands finden lassen, wie es sie in den 70ern gab?
Wie Sookee dann richtig einwendet, wird es nicht nur für Künstler_innen, sondern für alle in Zeiten von Globalisierung und zunehmend fragmentierten Teilöffentlichkeiten immer schwerer sich klar zu positionieren. Die Komplexität mancher Themen tut dazu ihr übriges. Samsa wünscht sich eine strikte Trennung zwischen Meinung („haben ziemlich viele Menschen“) und Haltung („lässt sich bei Bands auch immer weniger finden“). Woran er das festmacht? U. a. an der Crowdfundigkampagne von Marcus Wiebusch (But Alive, Kettcar), der für die Produktion seines Musikvideos „Der Tag wird kommen“ (zum Thema Homophobie im Fußball) 50.000 Euro gesammelt hat. Samsa fragt sich und in die Runde, warum Wiebusch das Geld nicht lieber dafür verwendet, um es direkt Initiativen gegen Homophobie zur Verfügung zu stellen? Die fragwürdige Instrumentalisierung von Themen wie Homophobie aus Imagegründen, soll Wiebusch an dieser Stelle zwar nicht unterstellt werden, etwas mulmig ist mir bei dieser Art von „Awareness-Rising“ aber schon.
Leider fehlt durch die generell sehr zerfahrene Diskussion, Raum für viele weitere spannende Fragen zu Jugendkulturen, die im Vorfeld angekündigt waren. Stattdessen macht Sookee ungeniert Eigenwerbung für ihr Label, dass „wie kein anderes fernab kapitalistischer Verwertungslogiken arbeitet“. Aber gut, auch Sympathieträgerinnen haben mal einen nicht so guten Tag. Und Stoppok rühmt sich dafür in seiner gut 40jährigen Karriere, auch ohne Majorlabel im Rücken, die Hallen gefüllt zu haben. Ärgert sich aber trotzdem, so mein Eindruck, darüber, dass er nie bei „Wetten dass..?“ eingeladen wurde. Da macht es dann am Ende auch fast gar nichts, dass Sookee nicht weiß, wer Marcus Wiebusch ist.
Um Distinktion bemüht
Dass sich angeblich 3.5000 Delegierte auf der Konferenz tummeln sollen merkt man bei der BMW zu keinem Zeitpunkt. Weder bei den Panels, an den Bars oder vor den Toiletten bilden sich nennenswerte Schlangen. Das mag zwar schlecht für die BMW sein, deren Relevanz ja schon seit Bestehen in Frage gestellt wird, für mich bedeutet das eine sehr entspannte Konferenzatmosphäre. Selbiges lässt sich auch über die Konzerte im Rahmen von First We Take Berlin sagen. Ob nun im YAAM bei Zugezogen Maskulin, in der Berghain Kantine bei Ballet School oder im Astra bei Zoot Woman. Reindrängeln muss man sich nirgends. Bei den Musikevents wird aber noch stärker deutlich, wie wenig es der BMW gelingt, sich vom dem üblichen Partyangebot Berlins distinktiv abzuheben.
Mit einer Überraschung wartet dann der Abschlußevent der BMW, der New Music Award, auf. Newcomer findet man unter den Bands im Wettbewerb zwar kaum, denn fast alle haben schon einen Plattenvertrag in der Tasche und auch der Blick ins Programmheft manifestiert eher, was beim Panel zu Frauen und Vielfalt im Musikbusiness schon schlechte Laune machte: In einem Meer von Indierock- und Hip-Hop Acts, viele mit einer Art Casper-Clon in ihren Reihen, finden sich gerade mal drei Künstlerinnen im Wettbewerb wieder. Doch worin besteht dann die Überraschung? Dass am Ende eine von ihnen, nämlich die Berliner Musikerin Lary den NMA gewinnt. Es bleibt also die vage Hoffnung, dass sich musikalisches Talent, ob im Mainstream oder Underground, immer wieder durchsetzen kann und wir vielleicht schon bei der kommenden BMW nicht mehr über spezielle Awards zur Förderung von Musikerinnen nachdenken müssen.
Giuseppina Lettieri
Gefällt mir Wird geladen …






 Das 1967 in den USA gegründete Magazin „Rolling Stone“ ist bis heute ein interessantes Blatt geblieben. Autoren wie Lester Bangs und Hunter S. Thompson probierten den später so genannten „New Journalism“ aus und etablierten diese Arbeitsmethode als Stil. Die Inhalte waren nicht nur Popmusik, sondern auch Underground, große Politik und Alltag. Über die gesamte Erscheinungszeit wurden ihm Preise sowohl für Inhalt als auch Form verliehen.
Das 1967 in den USA gegründete Magazin „Rolling Stone“ ist bis heute ein interessantes Blatt geblieben. Autoren wie Lester Bangs und Hunter S. Thompson probierten den später so genannten „New Journalism“ aus und etablierten diese Arbeitsmethode als Stil. Die Inhalte waren nicht nur Popmusik, sondern auch Underground, große Politik und Alltag. Über die gesamte Erscheinungszeit wurden ihm Preise sowohl für Inhalt als auch Form verliehen. Dotschy Reinhardt, eine in Berlin lebende Sinteza, thematisiert in diesem Buch die in der weißen Mehrheitsbevölkerung weit verbreiteten Klischees von Sinti und Roma. Dabei spürt die in Berlin lebende Jazzmusikerin, Schriftstellerin und Aktivistin antiziganistische Ressentiments fernab von NPD-Wahlkampfplakaten dort auf, wo wir sie zunächst nicht unbedingt erwarten würden: in der Popkultur.
Dotschy Reinhardt, eine in Berlin lebende Sinteza, thematisiert in diesem Buch die in der weißen Mehrheitsbevölkerung weit verbreiteten Klischees von Sinti und Roma. Dabei spürt die in Berlin lebende Jazzmusikerin, Schriftstellerin und Aktivistin antiziganistische Ressentiments fernab von NPD-Wahlkampfplakaten dort auf, wo wir sie zunächst nicht unbedingt erwarten würden: in der Popkultur.