von Gabriele Vogel (aus dem Journal der Jugendkulturen #17, Winter 2011)
Tagungsbericht
Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Hamburg veranstaltete am 29. und 30. September 2011 eine Konferenz zur Frage nach der Kategorie „Männlichkeit“ im Kontext der deutschen Musikkultur nach 1950. Ausgehend von der Feststellung, dass sich die Forschungen im Bereich der Musik bisher zumeist mit der kulturellen Anteilnahme von Frauen befassten, erscheint es gleichwohl mehr als angebracht, sich ebenso der Konstruktion und Darstellung von Männlichkeiten in weit gefächerten musikalischen Kontexten zu widmen. Das Ziel ist hier eine im Idealfall symmetrische Musikgeschichtsschreibung, eine gendersensible Musikpädagogik und Soziale Kulturarbeit.
Grundlage der aktuellen Forschung zu „Männlichkeit“ ist es, diese als ein relationales Konzept zu betrachten. Männlichkeit existiert folglich nicht „an sich“, sondern immer nur in Abgrenzung und im Gegensatz zu einer – ebenfalls gesellschaftlich konstruierten – Weiblichkeit. Weiterhin kann nicht von einer singulären, unveränderlichen Männlichkeit gesprochen werden, da diese in diversen (sub‑)kulturellen und historischen Kontexten in unterschiedlichen Erscheinungsformen zu beobachten ist.
Seit sich Raewyn Connell in den 1980/90er Jahren ausführlich mit Masculinities (so der Originaltitel ihres 1995 erschienen Buches, deutscher Titel: Der gemachte Mann) auseinandergesetzt hat, wird in der kritischen Männlichkeitsforschung zumeist das Konzept der Hegemonialen Männlichkeit miteinbezogen. Connell zufolge stehen Männlichkeiten in einer hierarchischen Ordnung zueinander, innerhalb derer die Hegemoniale Männlichkeit die zu einem bestimmten Zeitpunkt akzeptierte Form von Männlichkeit darstellt. Andere, so genannte Untergeordnete Männlichkeiten – untergeordnet z. B. aufgrund ihrer (nicht hetero‑)sexuellen Orientierung – oder Marginalisierte Männlichkeiten – marginalisiert z. B. aufgrund ihrer (nicht weißen) Hautfarbe – existieren laut Connell nachrangig. Gemeinsam jedoch ist sämtlichen Männlichkeiten eine Komplizenschaft untereinander, die dazu führt, dass alle Männer von der so genannten patriarchalen Dividende profitieren, die sich aus der allgemeingesellschaftlichen Benachteiligung von Frauen ergibt und sich beispielsweise in der Ausgrenzung und Unsichtbarmachung von Frauen in bestimmten, als „männlich“ konnotierten Domänen auswirkt. Der Bereich der Musik ist eines der Felder, in dem dieses Phänomen nach wie vor hohe Gültigkeit erlangt. So war es ein Anspruch der Tagung, die in diversen Musikgenres erscheinenden Formen von Männlichkeit nicht als selbstverständlich gegeben hinzunehmen, sondern genau diese zu untersuchen und zu hinterfragen.
Die vorgestellten Beiträge beschäftigten sich sowohl mit Bereichen der so genannten E‑Musik (von Beethoven bis Stockhausen) als auch der U‑Musik (von Volksmusik über Heavy Metal bis Gangstarap). Thematisiert wurden Aspekte der unterschiedlichen Rezeption von Musik im geteilten Deutschland der Nachkriegszeit ebenso wie einzelne Instrumente „am Manne“, wie die Trompete oder die Gitarre, bis hin zu der Relevanz von Genderaspekten bei musikbegeisterten Jugendlichen und in der Jugendkulturarbeit. Der geplante Ablauf gliederte sich, nach einer Begrüßung und einem Eröffnungsvortrag, in Sektion 1: Die Kategorie Männlichkeit im 20. und 21. Jahrhundert und ihre Relevanz für die Musik in Ost‑ und Westdeutschland am Donnerstag, am Freitag folgten Sektion 2: Instrument – Institution – Männlichkeiten, Sektion 3: Männlichkeit(en) in popularmusikalischen Gattungen und Sektion 4: Männlichkeiten und ihre Relevanz für die Musik‑ und Sozialpädagogik.
Nach der Begrüßung durch den Dekan Dr. Matthias Pape, die Gleichstellungsbeauftragte Prof. Dr. Sabine Stövesand und die Tagungsleiterin Prof. Dr. Marion Gerards eröffnete Prof. Dr. Stefan Horlacher die Vortragsreihe mit dem Beitrag „Von den Gender Studies zu den Masculinity Studies. Aktuelle Konzepte der Männlichkeitsforschung im Überblick“. Das Referat bot einen Einblick in den aktuellen Stand der Masculinity Studies, die, so wurde betont, keineswegs in Konkurrenz zu den Gender Studies stünden, als vielmehr diese ergänzend unterstützen würden, da die Geschlechterforschung in ihren Anfängen den Fokus zunächst zentral auf Weiblichkeit bzw. Frauen gerichtet hätte. Dass jedoch der Status der Männlichkeit, wie auch immer dieser definiert sein mag, ausgesprochen mühsam zu erreichen sei und „Mann“ diesen nicht selbstverständlich zugesprochen bekäme, rechtfertige die intensive und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Männlichkeitskonzepten. Diese erscheinen zudem, je nach wissenschaftlicher und auch politischer Ausrichtung, unterschiedlich und streitbar. So gebe es durchaus die Kritik an Connells Ansatz, er löse sich nicht ausreichend von einer patriarchalen Geschlechterkonzeption und bipolaren Geschlechterkonstruktion. Weitere Ansätze, die im Eröffnungsvortrag nur angerissen wurden, wie beispielsweise die der Männerrechtsbewegung oder auch spirituelle, moralisch‑konservative oder soziobiologische Perspektiven, zielen zudem auf eine weit essentiellere Ausrichtung von Männlichkeitskonzeptionen.
Die beiden nachfolgenden Vorträge, „Rückblicke. Ausblicke: Der Komponist als gottgleiche Gestalt“ von Prof. Dr. Beatrix Borchard und „Beethoven 1970: Männlichkeitsinszenierungen als politische Strategie in Ost und West“ von Dr. Nina Noeske widmeten sich dem Bereich der klassischen Musik und hier vor allem dem Komponisten Ludwig van Beethoven. Prof. Dr. Beatrix Borchard referierte zu Beethoven als „Tonschöpfer“, einer Art Gottgestalt im jüdisch‑christlichen Sinn, die bis vor kurzem nur männlich gedacht werden konnte und kam damit zu der Frage, auf welchen Denkmustern diese Analogie zwischen Genie und Gott beruhe und ob dieses Rollenmodell auch heute noch Gültigkeit erlange. Auch der nachfolgende Beitrag beschäftigte sich mit der Rezeption von Beethoven, dessen 200. Geburtstag in den 1970er Jahren sowohl in der BRD als auch in der DDR vor dem Hintergrund unterschiedlicher politischer und kultureller Vereinnahmung inszeniert wurde.
Den Abschluss des ersten Konferenztages bildete das Thema „Männlichkeit/en in populärer Musik – Artikulationsmuster in den Deutschlands der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts“. Dr. Monika Bloss fragte in diesem Kontext nach der Beständigkeit konservativer Geschlechterbilder und richtete den Fokus zunächst auf den deutschen Schlager in den ersten Nachkriegsjahrzehnten. Während die Darstellung einer bürgerlichen Idylle und die Präsentation einer solidarischen Männergemeinschaft im westdeutschen Mainstream vorherrschten, wurden zunehmend außerdeutsche Traditionen vor allem nach US‑amerikanischem Vorbild übernommen, wobei das Erscheinungsbild männlicher Interpreten im normierenden Anzug und mit zurückhaltenden Bewegungen auf der Bühne relativ ungebrochen blieb. Jedoch entsprach das im Schlager vermittelte Männlichkeitsbild immer weniger den Vorstellungen der Jugendlichen, wie die in der Bravo veröffentlichten Hitlisten belegen. Zur Mitte der 1970er Jahre hin fanden sich kaum noch deutsche Interpreten und Schlagertitel in den Bravo‑Charts, welche den Hörergeschmack stärker repräsentierten als die von der Musikindustrie erstellten Hitparaden. Ursächlich war hier nicht nur ein verändertes Männlichkeitsbild, auch das Rezeptionsverhalten der Jugendlichen hatte sich stark in Richtung internationaler Pop‑ und Rockmusik orientiert. Darin manifestierte sich der eigentliche Protest gegen die Schlagerwelt und damit auch gegen das Denken und die Spießbürgerlichkeit der Eltern. Junge Männer erlaubten sich hier, eigene Ansprüche zu formulieren und gegen Erwartungsmuster aufzubegehren, sei es mit langen Haaren oder mit lauten Gitarrenklängen und anzüglichen Hüftbewegungen.
Die Situation in der DDR erschien in den 1950er Jahren kaum unterschiedlich zu der im Westen. Nach dem Mauerbau waren US‑amerikanische Künstler über das Radio präsent und über verfügbare Schallplatten, die unter Jugendlichen zirkulierten. Die allgemeine Empörung über den Rock’n’Roll ähnelte der im Westen. Die Distanzierung zur US‑amerikanischen Kultur hatte jedoch in Ostdeutschland Konsequenzen, die nicht nur ideologisch, sondern auch ökonomisch motiviert waren. So trat 1958 die so genante 60:40‑Regelung in Kraft, die vorschrieb, dass der überwiegende Teil von Veranstaltungen und Sendungen von Komponisten stammen musste, die den Wohnsitz in der DDR, Sowjetunion oder in Volksdemokratien hatten und im sozialistischen Alltag verwurzelt waren. Vorgabe war es, die Texte frei von bürgerlicher Dekadenz und sentimentalem Kitsch zu halten. Darüber, wie dies musikalisch oder anhand des Künstlerimages hergestellt werden sollte, gab es nur vage Vorstellungen, vor allem sollte eine „saubere“ Lebensweise abgebildet werden. Unklar war auch, wie diese Vorgaben in quantitativer Hinsicht bedient werden sollten, geschweige denn, wie geschlechtsrelevante Aspekte darin Platz finden sollten.
Am Beispiel des Soul kann schließlich aufgezeigt werden, wie groß die Diskrepanz zwischen einer sinnlichen, sexualisierten Musik und dem kopflastigen Männerbild in Deutschland war. Hier ließ sich eine auffallende Reserviertheit selbst der Jugendgeneration gegenüber amerikanischen Musikern erkennen, da anfangs fast gänzlich darauf verzichtet wurde, diese Musikrichtung zu imitieren und nur wenige Bands Soultitel in ihr Repertoire aufnahmen. Etwas breiter gelangte Soul erst im Laufe der 1970er Jahre in den popmusikalischen Alltag, als verschiedene Synthesen von Rockstilen praktiziert und Jazzrock, Funk und Soul zu einem Konglomerat vermischt wurden. Ein wichtiges zentrales Prinzip von Männlichkeit, nämlich Kontrolle, hier im Sinne von Kontrolle über den eigenen Körper, zeigte sich in Deutschland eher als ein Ausblenden des Körpers denn als körperliche Bewegung, kontrolliert in Form des Tanzens. Ein weiteres Beispiel des Umsetzens von Kontrolle im Kontext von Musik war, dass sie, kombiniert mit Leistungsfähigkeit, in Deutschland eher perfektes Handwerk bedeutete als freudiges Musizieren.
 Den Einstieg in den zweiten Konferenztag umriss die Frage „Ist das Männliche das Allgemeine?“. Hierzu referierte Prof. Dr. Dörte Schmidt über „Komponisten zwischen Abstraktion und Konkretion im Umfeld der Darmstädter Avantgarde mit einem Seitenblick auf Stockhausens Originale“. Im Anschluss ging Dr. Verena Barth speziell auf „Männlichkeitsinszenierungen im Umfeld der Trompete“ ein und führte aus, inwieweit sich geschlechtsspezifische Zuschreibungen zum männlichen Bereich am Instrument Trompete traditionell manifestierten. Anhand von Stereotypen lässt sich eine spezifische Form von Männlichkeit erkennen, die der Trompete klischeegemäß zugeschrieben und akustisch, optisch und in Interaktion dargestellt wird. Die Männlichkeitsinszenierung des Trompeters zeichnete sich durch Männerbündelei, Trinkfestigkeit, hohe Körperkraft und eher geringeren Intellekt aus, zudem folgte ihm der Ruf, ein ausgesprochener Fraueneroberer zu sein. Im Gegensatz dazu war z. B. die Geige ein Instrument der Akademiker, aber auch Flöte war schon an Musikhochschulen studierbar, während Trompete noch lange als Lehrberuf galt.
Den Einstieg in den zweiten Konferenztag umriss die Frage „Ist das Männliche das Allgemeine?“. Hierzu referierte Prof. Dr. Dörte Schmidt über „Komponisten zwischen Abstraktion und Konkretion im Umfeld der Darmstädter Avantgarde mit einem Seitenblick auf Stockhausens Originale“. Im Anschluss ging Dr. Verena Barth speziell auf „Männlichkeitsinszenierungen im Umfeld der Trompete“ ein und führte aus, inwieweit sich geschlechtsspezifische Zuschreibungen zum männlichen Bereich am Instrument Trompete traditionell manifestierten. Anhand von Stereotypen lässt sich eine spezifische Form von Männlichkeit erkennen, die der Trompete klischeegemäß zugeschrieben und akustisch, optisch und in Interaktion dargestellt wird. Die Männlichkeitsinszenierung des Trompeters zeichnete sich durch Männerbündelei, Trinkfestigkeit, hohe Körperkraft und eher geringeren Intellekt aus, zudem folgte ihm der Ruf, ein ausgesprochener Fraueneroberer zu sein. Im Gegensatz dazu war z. B. die Geige ein Instrument der Akademiker, aber auch Flöte war schon an Musikhochschulen studierbar, während Trompete noch lange als Lehrberuf galt.
Sowohl in vorchristlichen als auch in außereuropäischen Kulturen war die Trompete im Kontext von Militär oder Ritualen präsent und zumeist Männern vorbehalten. Zudem galt sie als Führungsinstrument. Ab Mitte des vergangenen Jahrhunderts wurden Trompeten zunehmend auch von Frauen gespielt. Unter Blechbläsern, die allgemein in Gruppen auftraten, wurden Trompeterinnen zunächst als „die Harmonie störend“ empfunden. Leichter hatten es hier Frauen, die relativ maskulin auftraten. Nach und nach änderten sich jedoch der Klang und die Spielweise der Trompete. Dämpfer wurden eingesetzt, der Ton der Trompete wurde weicher. Bisherige Normen verloren ihre Gültigkeit. Erkennbar sind hier Aushandlungsprozesse, die sowohl stereotype Repräsentationsmuster als auch soziale Praktiken betreffen. Die künstlerische Selbstdarstellung beinhaltet immer wieder auch eine interaktive Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechtsidentität und gesellschaftlichen Gendernormen.
Den zweiten Beitrag zu einem spezifischen Musikinstrument bot Dr. Birgit Kiupel mit dem Vortrag „E=XY? Die E-Gitarre und die Inszenierungen von Männlichkeiten“. Anhand von Interviews mit dem Gitarristen Ladi Geisler, der im Nachkriegsdeutschland die erste E‑Gitarre bastelte und Achim Reichel, der von seiner Suche nach musikalischem Ausdruck in der deutschen Rockmusik erzählt, werden Versuche aufgezeigt, sich auf musikalischem Wege einer erfolgreichen männlichen Identität zu versichern. Auch der Sänger und Songwriter Carsten Pape konnte feststellen, dass ansonsten eher unscheinbare junge Männer dank des Gitarrenspiels Anerkennung finden können. Kritisch hinterfragt wurden starre Rollenerwartungen am Beispiel der transsexuellen Gitarristin Carola Kretschmer. Sie spielte in Udo Lindenbergs „Panikorchester“, das im sonst eher geschlechterunflexiblen Musikbusiness eine bemerkenswerte Ausnahme darstellt.
Mit Dr. Florian Heeschs Referat „Männlichkeitsperformanz mit hoher Stimme? Zum Heavy Metal in den 70er und 80er Jahren“ wurde die Reihe der Beiträge zu popularmusikalischen Gattungen eröffnet. Im Bereich des Metal, der ganz besonders von einer Dominanz der Männer geprägt ist, stehen die oft hohen Stimmlagen in einer bemerkenswerten Diskrepanz zum vorgestellten kernigen Männlichkeitsbild des Metal‑Rockers, zumal auch das Kreischen und Schreien gemeinhin eher mit Weiblichkeit assoziiert wird. Ebenso überschreitet das Erscheinungsbild der Musiker mit langen Haaren und Make‑up – und das nicht nur im Glamrock – alle Grenzen, die für eine klassische Männlichkeitsperformance gelten. Wie ambivalent kulturelle Normen ausgelegt werden können, zeigt sich an diesem Beispiel deutlich. Erklärt man die lange Mähne als wild, die Schminke als Kriegsbemalung und das Schreien als aggressiv, kombiniert mit der Herausstellung der Virtuosität eines hohen Gesangs, wird das, was sonst als weibisch verrufen ist, zu Attributen höchster Männlichkeit umdeklariert. Andere Vokalstile, wie das so genannte Growling, standen wiederum bei Metalsängerinnen zunächst im Widerspruch zur weiblichen Rolle, wurden jedoch sukzessive akzeptiert. Spannungsverhältnisse zur kulturell dominanten Zuordnung von Stimmregister und Geschlecht können folglich aushandelbar sein, ohne die herkömmliche Geschlechterhierarchie allzu weitreichend in Frage zu stellen.
Die eingangs gestellte Frage „Wann ist ein Mann ein Mann?“, so stellte Dr. Martin Loeser zu Beginn seines Vortrages „Männlichkeitskonstruktion in westdeutscher Pop‑ und Rockmusik am Beispiel von Marius Müller‑Westernhagen und Herbert Grönemeyer“ fest, könne auch er nicht endgültig beantworten. Was als männlich gelte, müsse immer wieder ausgehandelt werden, sowohl im eigenen Bereich als auch in der Gesellschaft. Im Werk beider genannten Rockbarden werden anhand verschiedener Medien wie Liedtexte, Musik, Bilder oder Videoclips durchaus unterschiedliche Männlichkeitsentwürfe vorgestellt. Da gerade die Rock‑ und Popmusik seit der Mitte des 20. Jahrhunderts eine große und vielschichtige Verbreitung in einer weit gefächerten Zielgruppe und fast allen Alterskategorien gefunden hat, wird dieser Musikrichtung eine beachtliche Relevanz für die soziale Vermittlung von Geschlechterbildern zugesprochen. Diese können mithilfe populärer Musik sowohl konserviert als auch in Frage gestellt und neu entworfen werden. Anhand der deutschsprachigen Musik weithin rezipierter Interpreten wie Westernhagen und Grönemeyer ist feststellbar, dass Kunst gesellschaftliche Prozesse widerspiegelt und ob und inwieweit diese ein Veränderungspotential enthält. Im Hinblick auf die von den beiden Musikern skizzierten Männlichkeitskonzepte kann zudem speziell nach dem Verhältnis zwischen der Intention der Künstler und der vermutlich differenten und differenzierten Rezeption eines heterogenen Publikums gefragt werden.
Im Anschluss widmete sich Martin Seeliger mit dem Thema „Zwischen Affirmation und Empowerment – Gangstarapimages als umkämpfte Bilder“ einem Subgenre des Rap in Deutschland. Vorläufer war der ursprünglich in den USA der Endsiebziger Jahre entstandene Hip Hop, der vor dem Hintergrund ansteigender Ressentiments gegenüber Zuwanderern in den frühen 1980er Jahren auch in Deutschland ankam. Diese Musikrichtung zentriert sich um eine Männerwelt mit einem Männlichkeitskult, der auf einer traditionellen Geschlechterhierarchie basiert, beinhaltet eine Verschränkung der Klassen‑ und Ethnizitätsdimension mit dem Merkmal ausgeprägter Randständigkeit und fokussiert auf den Körper als Ort der Zurschaustellung von Symbolen und Artefakten, der zudem sexualisiert und als Hort von Dominanz und Stärke dargestellt wird. Während im Hip Hop jedoch Schwulen‑ und Frauenfeindlichkeit nicht zwangsläufig inbegriffen sind, bilden diese im Gangsterrap zentrale Grundlagen für musikalische Auseinandersetzungen, auf denen männliche Rangordnungskämpfe ausgetragen und Dominanzansprüche gegenüber Frauen zementiert werden. Zugehörige Assoziationsfelder sind das Leben „im Ghetto“ inklusive Migrationshintergrund und damit verbundenem Bildungsverlierertum als Begründungen für geringe Erwerbschancen und abweichende Verhaltensweisen. Bezeichnend ist der im Gangstarap auf sozialdarwinistischer Grundlage beruhende Wertekodex des „do or die“, das Überleben des stärkeren und autonomeren Individuums. Musikalisch thematisiert werden Ausgrenzungserfahrungen, das Leben auf der Straße, die Geschehnisse im eigenen, sozialräumlich benachteiligten Stadtteil. Der Rapper inszeniert sich dabei als Sprecher im Ghetto. Dadurch findet, neben der Abwertung anderer Personen und Gruppen, eine Selbstüberhöhung statt, welche die Aufstiegschancen für das eigene, erfolgreiche biografische Projekt zu verbessern verspricht.
Die Auseinandersetzung mit dem Gangstarap kann unter verschiedenen Gesichtspunkten geschehen. Neben einer subjektiven Dimension, in der danach gefragt wird, warum Menschen zu Gangstarappern werden und wie Adressaten mit den vorgestellten Identifikationsangeboten umgehen, kann in einer kulturindustriellen Dimension die Frage nach dem Warencharakter von Kulturprodukten gestellt werden und nach der Rolle, die die Musikindustrie bei der Konstruktion der Bildwelten des Gangstarap spielt. Eine dritte Dimension fragt nach der Bedeutung von Gangstarap innerhalb der symbolischen Ordnung eines gesellschaftlichen Repräsentationsregimes und nach der Relevanz von Gangstarapimages als Bezugspunkte für die Selbstverortung und Fremdzuschreibung von Sprechern in Bezug zu sozialstrukturell verpackten Ungleichheiten.
Interpretiert werden kann Gangstarap als Versuch der Aktualisierung hegemonialer Männlichkeit, indem der Rapper zeigt, dass er trotz schlechter Voraussetzungen aufgrund ethnischer Zugehörigkeit und geringer Bildung schließlich doch Erfolg, Wohlstand, sexuelle Potenz und Durchsetzungsfähigkeit besitzt. Als Verweis auf die eigene Leistungsfähigkeit, ein Kernelement der hegemonialen Männlichkeit, wird betont, dass man es nicht von der Mitte aus, sondern von ganz unten nach oben geschafft hat. Ebenso kann Gangstarap aber auch als einem „Klassenkampf von oben“ dienlich wahrgenommen werden. Indem unliebsame Eigenschaften wie Faulheit, Delinquenz, Amoralität und Homophobie dem generalisierten Anderen, der Unterschicht zugeschrieben werden, kann sich die bürgerliche Mitte beruhigt ihrer selbst vergewissern.
Eine weit weniger urbane musikalische Gattung wurde von Prof. Dr. Gerlinde Haid vorgestellt. Ihr Vortrag: „Von Männlichkeiten und vom Umgang mit deren Symbolen in der alpenländischen Volksmusik“ führte in die Traditionen der österreichischen Tanzmusikgruppen ein, deren Besetzung bis in die 1950er Jahre – mit Ausnahme von weiblichen Familienmitgliedern – nur aus Männern bestand. Gleiches galt in Vereinen und bei Faschingsbräuchen. Selbst so genannte „Trommelweiber“ waren ausschließlich kostümierte Männer. Erst in den 1970/80er Jahren kam langsam Veränderung in die Szene, Musikerinnen traten zunehmend selbstbewusst auf, spielten in der Volksmusik mit und durften sogar Hüte tragen, was zuvor ebenfalls nur Männern vorbehalten war.
Den letzten Teil der Konferenz bildeten zwei Beiträge zur Sozialen und Kulturellen Arbeit mit Jugendlichen. Prof. Dr. Marion Gerards Vortrag „Inszenierung von Männlichkeiten in musikalischen Lebenswelten von Jungen und Mädchen“ befasste sich mit nach wie vor männlich dominierten Jugendkulturen und Musikszenen, in denen trotz diverser Gegenbewegungen und Fördermaßnahmen heteronormative Geschlechterbilder vorherrschen. Ziel der Sozialen Arbeit mit Musik ist es, das Leben selbstständig und eigenverantwortlich zu bewältigen. Gerade bei Jugendlichen sollte die Bedeutungsdimension von Musik nicht unterschätzt werden. Der Musikgeschmack spielt eine wichtige Rolle bei der Selbststilisierung und damit der Identitätsbildung, auch bei der Bildung der Geschlechtsidentität. Anhand von Musik können Jugendliche sich unter Gleichaltrigen zugehörig fühlen, aber auch abgrenzen, sie hilft bei der sozialen Orientierung und der Partnerwahl.
Die Begeisterung für problematische Musikstile wie dem so genannten Porno‑Rap wirft die Frage auf, inwieweit homophobe und misogyne Songs Einfluss auf Jugendliche und deren soziale Wirklichkeit haben. Es hat sich gezeigt, dass die Vorbildfunktion von Musik abhängig von der subjektiven Bedeutungszuschreibung ist. Eine entsprechende Orientierung findet meistens nur dann statt, wenn Einstellungen und Verhaltensstrukturen bereits ausgeprägt sind, denn das familiäre und soziale Umfeld ist entscheidend für die sexuelle Sozialisation. Gerade Mädchen erleben jedoch in Musiksubkulturen eine Ausweitung der traditionellen Frauenrolle, sie lernen, sich Respekt und Raum zu verschaffen. Insbesondere das aktive Musikmachen bringt Selbstbestätigung, die zu mehr Selbstbewusstsein verhilft – gerade auch in der Geschlechterrolle, die bei Mädchen doch eher zurückhaltend angelegt ist. Wünschenswert ist daher eine gendersensible Jugendarbeit. Beinhalten sollte diese eine Medienkritik mit Reflexion der Textinhalte und eine Sozialraum‑Analyse ebenso wie Genderprojekte, speziell Musikprojekte für Mädchen in „Männermusikszenen“ und zudem Evaluation und Forschung.
Judith Müller erklärte anschaulich die “Inszenierungen von Musik und Männlichkeit – Konsequenzen für die Jugendkulturarbeit” und berichtete aus der Praxis. In der Arbeit mit Mädchen‑ oder auch gemischten Bands lassen sich gerade bei jungen Frauen Kompetenzen fördern, da häufig Rollenstereotype unreflektiert fortgesetzt werden und Mädchen dazu neigen, sich selbst aufgrund männlicher Dominanz und fehlender weiblicher Vorbilder einzuschränken, indem sie z. B. klischeegemäß den Gesangspart übernehmen anstatt zur unbekannten E‑Gitarre oder gar zum Schlagzeug zu greifen. So wird in der Bandarbeit Jugendlichen Raum geboten zu experimentieren und dabei auch gängige Rollenbilder zu hinterfragen. Ebenso kann über kontroverse Inhalte von Texten diskutiert werden. Aufgabe einer pädagogischen Fachkraft ist es hier, unterschiedliche Lebenswelten der Jugendlichen zu kennen und zu berücksichtigen und allen einen gleichberechtigten Zugang zu einem Bandprojekt zu ermöglichen. Alternatives Denken und Handeln von Jugendlichen sollte erkannt und gefördert werden, da unkonventionelle Jugendliche häufig angreifbarer sind und daher besondere Unterstützung durch Pädagog_innen benötigen. Letztlich gilt es, mit der Jugendkulturarbeit ein Umdenken und einen gleichberechtigten Umgang mit (Geschlechter‑)Differenzen zu fördern.
Mit einer allgemeinen Abschlussdiskussion wurde die Konferenz beendet. Insgesamt gestaltete sich die Tagung ausgesprochen facettenreich und inspirierend. Bedauerlich war nur, dass nach den einzelnen Beiträgen oft nicht genug Zeit für Fragen und Diskussion blieb. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn ein Tagungsband zum Nachlesen und Vertiefen der vorgestellten Themen erscheinen würde.
(Ergänzung 25.09.2014: Es ist in der Zwischenzeit ein Tagungsband erschienen, erhältlich beim Allitera-Verlag)
Die diesem Bericht beigefügte Fotografie ist nicht im Umfeld der Tagung entstanden und bildet keine der hier erwähnten Personen, Ereignisse und Musikgenres ab. Sie dient lediglich der Illustration. Für die Zurverfügungstellung des Fotos danke ich Eric Sagot und Frank Daubenberger.
Gefällt mir Wird geladen …















 Eine Projektgruppe der Berliner Clubcommission bietet ab diesem Monat eine Stadtführung zur Technoszene und Clubkultur ab 1990 an. Wir waren letzte Woche bei der Pressetour dabei und haben uns von Eberhard Elfert, dem Sprecher der Gruppe, zeigen lassen, wie nach dem Mauerfall Räume angeeignet wurden, um Clubs für Liebhaber*innen elektronischer Musik zu eröffnen. Wie man bei der Tour, die entlang des ehemaligen Mauerstreifens vom Potsdamer Platz bis zur Arena am Ufer der Spree führt, gut nachvollziehen kann, ist Clubkultur in Berlin stark von Wanderungsbewegungen geprägt, da die Clubs in
Eine Projektgruppe der Berliner Clubcommission bietet ab diesem Monat eine Stadtführung zur Technoszene und Clubkultur ab 1990 an. Wir waren letzte Woche bei der Pressetour dabei und haben uns von Eberhard Elfert, dem Sprecher der Gruppe, zeigen lassen, wie nach dem Mauerfall Räume angeeignet wurden, um Clubs für Liebhaber*innen elektronischer Musik zu eröffnen. Wie man bei der Tour, die entlang des ehemaligen Mauerstreifens vom Potsdamer Platz bis zur Arena am Ufer der Spree führt, gut nachvollziehen kann, ist Clubkultur in Berlin stark von Wanderungsbewegungen geprägt, da die Clubs in 
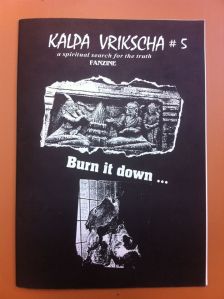







 Den Einstieg in den zweiten Konferenztag umriss die Frage „Ist das Männliche das Allgemeine?“. Hierzu referierte Prof. Dr. Dörte Schmidt über „Komponisten zwischen Abstraktion und Konkretion im Umfeld der Darmstädter Avantgarde mit einem Seitenblick auf Stockhausens Originale“. Im Anschluss ging Dr. Verena Barth speziell auf „Männlichkeitsinszenierungen im Umfeld der Trompete“ ein und führte aus, inwieweit sich geschlechtsspezifische Zuschreibungen zum männlichen Bereich am Instrument Trompete traditionell manifestierten. Anhand von Stereotypen lässt sich eine spezifische Form von Männlichkeit erkennen, die der Trompete klischeegemäß zugeschrieben und akustisch, optisch und in Interaktion dargestellt wird. Die Männlichkeitsinszenierung des Trompeters zeichnete sich durch Männerbündelei, Trinkfestigkeit, hohe Körperkraft und eher geringeren Intellekt aus, zudem folgte ihm der Ruf, ein ausgesprochener Fraueneroberer zu sein. Im Gegensatz dazu war z. B. die Geige ein Instrument der Akademiker, aber auch Flöte war schon an Musikhochschulen studierbar, während Trompete noch lange als Lehrberuf galt.
Den Einstieg in den zweiten Konferenztag umriss die Frage „Ist das Männliche das Allgemeine?“. Hierzu referierte Prof. Dr. Dörte Schmidt über „Komponisten zwischen Abstraktion und Konkretion im Umfeld der Darmstädter Avantgarde mit einem Seitenblick auf Stockhausens Originale“. Im Anschluss ging Dr. Verena Barth speziell auf „Männlichkeitsinszenierungen im Umfeld der Trompete“ ein und führte aus, inwieweit sich geschlechtsspezifische Zuschreibungen zum männlichen Bereich am Instrument Trompete traditionell manifestierten. Anhand von Stereotypen lässt sich eine spezifische Form von Männlichkeit erkennen, die der Trompete klischeegemäß zugeschrieben und akustisch, optisch und in Interaktion dargestellt wird. Die Männlichkeitsinszenierung des Trompeters zeichnete sich durch Männerbündelei, Trinkfestigkeit, hohe Körperkraft und eher geringeren Intellekt aus, zudem folgte ihm der Ruf, ein ausgesprochener Fraueneroberer zu sein. Im Gegensatz dazu war z. B. die Geige ein Instrument der Akademiker, aber auch Flöte war schon an Musikhochschulen studierbar, während Trompete noch lange als Lehrberuf galt.